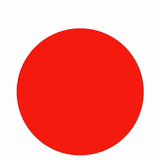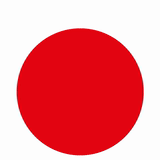Base de données des projets regiosuisse
Plus de 3'000 projets de 10 programmes d’encouragement et 15 thèmes : une vue d’ensemble unique en Suisse des projets de développement régional. Vous trouverez d’autres bases de données de projets ici. En cas de questions ou de suggestions, n’hésitez pas à contacter regiosuisse.