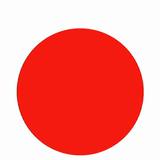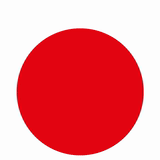-
Kreislaufwirtschaft ist zentraler Bestandteil des Nachhaltigkeitskonzeptes der Neuen Regionalpolitik (NRP) und trägt dazu bei, Ressourcen zu schonen, Emissionen zu senken und die regionale Wertschöpfung zu stärken.
-
Unternehmen setzen zunehmend zirkuläre Aktivitäten um: Insbesondere bei Unternehmen in periurbanen Regionen ist Kreislaufwirtschaft bereits verbreitet; Grossstädte hinken bei Umsetzung und Investitionen noch hinterher.
-
Förderung durch die NRP: Mit Wissenstransfer, Vernetzung und Projektfinanzierung unterstützt die NRP Unternehmen dabei, Kreislaufwirtschaft in ihre Strategien zu integrieren und die Transformation in den Regionen voranzutreiben.
Was bedeutet Kreislaufwirtschaft?
Die Kreislaufwirtschaft nimmt in der Regionalwirtschaft einen wichtigen Platz ein. Sie ist denn auch zentraler Bestandteil des Nachhaltigkeitskonzepts der Neuen Regionalpolitik (NRP) (weitere Informationen findest du z.B. im regioS Beitrag oder in diesem Podcast). Regiosuisse befasst sich deshalb mit der Kreislaufwirtschaft und nimmt in dieser Story die Kreislaufwirtschaftsaktivitäten der Unternehmen in den NRP-Regionen unter die Lupe. Kreislaufwirtschaft ist ein ganzheitlicher Ansatz, der den gesamten Kreislauf von der Rohstoffgewinnung über die Design-, Produktions-, Distributionsphase und eine möglichst lange Nutzungsphase bis hin zum Recycling betrachtet.
Das Ziel der Kreislaufwirtschaft besteht darin, Material- und Produktekreisläufe zu schliessen, um Rohstoffe immer wieder von neuem zu verwenden. Dadurch sollen sowohl die Umwelt als auch die Regionalwirtschaft gestärkt werden.
Warum ist die Kreislaufwirtschaft wichtig?
Ressourcen werden abgebaut und zu Produkten verarbeitet, meist einmalig verwendet und schliesslich entsorgt. Dabei entstehen entlang der gesamten Wertschöpfungskette – vom Abbau bis zur Entsorgung – Treibhausgas- und Feinstaubemissionen sowie Bio-diversitätsverluste. Zudem steigt der Flächenverbrauch. Mit der Kreislaufwirtschaft können diese Umwelt- und Gesundheitsbelastungen verringert werden, indem Rohstoffe im Kreislauf gehalten und so Emissionen, Flächenverbrauch und Schadstoffausstoss gesenkt werden.
Mit der Kreislaufwirtschaft sollen die Wertschöpfungsketten so angepasst werden, dass Ressourcen geschont und Materialien länger genutzt werden können. Sie umfasst zirkuläre Aktivitäten von Design und Produktion bis zu Vertrieb und Recycling. Beispiele hierfür sind langlebige Produkte, reparaturfreundliche Konstruktionen oder recyclinggerechtes Design. So können entlang der gesamten Wertschöpfungskette zirkuläre Lösungen umgesetzt werden. Weitere Informationen findest du in der Praxis-Toolbox Kreislaufwirtschaft von regiosuisse.
Wo steht die Schweizer Wirtschaft?
Der Statusbericht der Schweizer Kreislaufwirtschaft 2024 gibt Auskunft, wie stark Unternehmen in der Schweiz bereits Kreislaufwirtschaftsaktivitäten umsetzen und wie sich diese im Zeitverlauf entwickelt haben. Dabei wurde untersucht, wie die Kreislaufwirtschaft strategisch im Geschäftsmodell verankert ist, wie hoch die Investitionsanteile in die Kreislaufwirtschaft sind, wie viele Kreislaufwirtschaftsaktivitäten umgesetzt werden und schliesslich auch, wie gross die Umsatzanteile zirkulärer Produkte oder Dienstleistungen sind.
Rund jedes vierte Unternehmen an der «Frontier» hat das Konzept der Kreislaufwirtschaft bereits in sein Geschäftsmodell verankert. Unternehmen an der «Frontier» sind Unternehmen, die bereits mehr als 10 Kreislaufwirtschaftsaktivitäten umsetzen. Sie sind wichtig, weil sie eine Vorreiterfunktion wahrnehmen und ihre Erfahrungen und ihr Wissen als Orientierung für andere Unternehmen dienen und weil sie die Verbreitung der Kreislaufwirtschaft beschleunigen können.
Mit dieser zunehmenden Verankerung überrascht es nicht, dass es auch immer mehr Unternehmen gibt, die viele Kreislaufwirtschaftsaktivitäten umsetzen (von 8% auf 10%), und dass der Anteil der Unternehmen mit höheren Umsätzen gestiegen ist (von 12% auf 15%). Vieles deutet also auf eine verstärkte Umsetzung von Kreislaufwirtschaft hin. Ein Blick auf die Investitionen überrascht jedoch: Der Anteil der Unternehmen, die mehr als 10% ihrer Gesamtinvestitionen in die Kreislaufwirtschaft stecken, ist von 9% auf 7% gefallen. Offenbar wird heute pro Aktivität weniger investiert als noch bei der letzten Befragung 2020.
Regionale Unterschiede bei der Transformation hin zur Kreislaufwirtschaft
Entlang der regiosuisse-Raumtypen zeigen sich deutliche regionale Unterschiede. Besonders verbreitet ist die Kreislaufwirtschaft bei Unternehmen in periurbanen Regionen. Bereits ein Drittel der Unternehmen in diesen Regionen hat die Kreislaufwirtschaft fest in ihrer Strategie verankert. Das liegt deutlich über dem Wert der anderen Regionen, in denen nur 25% bis 27% der Unternehmen die Kreislaufwirtschat in ihrer Strategie verankert haben.
Ländliche Zentren erzielen bei den meisten Indikatoren eher durchschnittliche Werte, erreichen aber den Spitzenwert unter allen Raumtypen beim Umsatzanteil mit zirkulären Produkten und Dienstleistungen. Dies könnte auf die Präsenz spezialisierter Unternehmen oder auf eine gewachsene Tradition kreislauforientierter Praktiken wie Reparatur, Wiederverwendung und lokale Produktionskreisläufe zurückzuführen sein.
Grossstädte hingegen verzeichnen durchgehend niedrige Werte, besonders bei Investitionen und der Zahl umgesetzter Aktivitäten. Obwohl sie über wirtschaftliche Stärke, eine gute Infrastruktur und hohe Innovationskraft verfügen, scheint die Integration von Kreislaufwirtschaftsaktivitäten im urbanen Raum noch vergleichsweise gering zu sein.
Als mögliche Gründe für die Unterschiede zwischen den Regionen nennen die Autoren des Statusberichts 2024 insbesondere die verschiedenen Branchenstrukturen oder auch den Zugang zu Märkten, Technologien und Wissen. Um die Kreislaufwirtschaft in den Regionen besser zu verstehen und entsprechend auch gezielt fördern zu können, lohnt sich ein Blick auf die Motive der Unternehmen, weshalb sie Kreislaufwirtschaft betreiben, und auf die Hemmnisse, die sie and der Lancierung entsprechender Aktivitäten hindern.
Motive für Kreislaufwirtschaft aus Sicht der Unternehmen
Die Unternehmensbefragung zeigt, dass insgesamt das Nachfragepotenzial, die Kosteneinsparungen sowie die politischen Rahmenbedingungen in der Schweiz zu den Hauptmotiven gehören. 36% der Unternehmen geben an, dass Kreislaufwirtschaft ein Nachfragepotenzial auslöst, 32% sagen, dass sie damit Kosten einsparen können, und 31% nennen die politischen Rahmenbedingungen, die die Kreislaufwirtschaft fördern.
Wie auch beim Umsetzungsstand haben Unternehmen in ländlichen Regionen generell höhere Werte und somit eine breitere Motivlage als Unternehmen in Städten. Nebst den bereits genannten Motiven werden in den ländlichen Regionen auch häufig die Beziehung zu Lieferanten und Abnehmern, die Erwartungen der Mitarbeitenden sowie der gesellschaftliche Druck genannt. Es gibt also diverse Beweggründe für die Unternehmen, um auf Kreislaufwirtschaft zu setzen.
Hürden auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft
Wie eingangs gesehen, gibt es trotz zahlreicher Motive und dem volkswirtschaftlichen Nutzen von Kreislaufwirtschaft noch viel Potenzial für die Umsetzung weiterer Aktivitäten. Eine zentrale Herausforderung bei der Umsetzung der Kreislaufwirtschaft ist aktuell, dass sich viele Kreislaufwirtschaftsaktivitäten erst langfristig auszahlen. Der Zeithorizont von Unternehmen ist häufig relativ kurzfristig, was Investitionen in Kreislaufwirtschaftsaktivitäten hemmen können. Beispielsweise ist die Verwendung von Primärrohstoffen meist die kostengünstigere Alternative als die Verwendung von recycleten Materialien. Die dadurch höheren Produktionskosten gewichten Unternehmen häufig höher als die geringere Abhängigkeit von Importen, die sich in der langen Frist durch Kreislaufwirtschaftsaktivitäten ergeben würde. Zwar gibt es auch Aktivitäten, wie bspw. der Umstieg auf ressourcenschonendere Produktionsprozesse, die unmittelbar zu Kosteneinsparungen und Effizienzgewinnen führen können, dennoch dominieren in vielen Fällen die wahrgenommenen hohen Investitionskosten und bremsen den Umstieg auf Kreislaufwirtschaftsaktivitäten.
Diese Grundproblematik widerspiegelt sich auch in den Ergebnissen der Unternehmensbefragung im Rahmen des Statusberichts 2024. Als häufigste Hürden nennen Unternehmen die hohen Investitionskosten, den Mangel an qualifiziertem Personal und die hohe Marktunsicherheit. Je nach Region gibt es auch hier wieder Unterschiede, welche Hemmnisse besonders ins Gewicht fallen. Auffallend ist, dass gerade die ländlichen Regionen die Hemmnisse höher einschätzen, obwohl sie Kreislaufwirtschaftsaktivitäten bereits stärker angehen. Dies gilt sowohl für die drei genannten Hemmnisse als auch für weitere Hemmnisse wie die fehlende Management- bzw. Planungskapazität oder die Finanzierungsmöglichkeiten.
Gezielte Förderung der Kreislaufwirtschaft durch die Neue Regionalpolitik (NRP) durch Wissen, Vernetzung und Unterstützung
Um die Kreislaufwirtschaft weiter voranzutreiben und Hemmnisse abzubauen, stehen gezielte Förderangebote zur Verfügung. Aufgrund der unterschiedlichen Ausgangslage in den Regionen, können kantonale und regionale Massnahmen dabei besonders wichtig sein. Die Kreislaufwirtschaft ist denn auch zentraler Bestandteil des Nachhaltigkeitskonzepts der Neuen Regionalpolitik (NRP). Die NRP fördert die Kreislaufwirtschaft auf diversen Ebenen.
So stellt sie Wissensgrundlagen zur Verfügung und bietet Raum für den Erfahrungsaustausch und die Vernetzung von Akteuren. Über die Plattform Kreislaufwirtschaft und Regionalentwicklung können sich Akteurinnen und Akteure der Regionalentwicklung Wissen und Kompetenzen über die Kreislaufwirtschaft aneignen. Zudem gibt es für Unternehmen Coaching Angebote für Produkt- und Prozessinnovationen, die im Rahmen der Regionalen Innovationssysteme (RIS) angeboten werden. Die NRP stellt auch Fördermittel für innovative Projekte zur Verfügung, die gezielt Aktivitäten im Rahmen der Kreislaufwirtschaft angehen.
Praxisbeispiele: So funktioniert Kreislaufwirtschaft in den NRP-Regionen

Das Innovationsnetzwerk Ostschweiz, INEOS, bietet ein Coaching-Angebot zu Kreislaufwirtschaft in der Region an. Im Rahmen der INOS-Plattform «Wirtschaften in Kreisläufen» bietet INOS Unternehmen Coachings durch Fachexpertinnen und Fachexperten an. Dadurch wurden bereits diverse erfolgreiche Projekte realisiert. Zum Beispiel konnte die Auftriib GmbH mit Hilfe des Coachings von INOS ihre nachhaltigen Materialinnovationen gezielt weiterentwickeln und einen wichtigen Beitrag leisten, die Kreislaufwirtschaft im Sport- und Freizeitbereich voranzubringen.

Ein Beispiel für ein Projekt, welches dank der Projektfinanzierung der NRP aufgebaut wurde, war «Kreislaufwirtschaft im Seeland». Das Mitwirken, Vernetzen und der Wissenstransfer bilden den Kern des Projekts. Verschiedene Gastronomiebetriebe im Seeland haben sich entlang der gesamten Wertschöpfungskette zusammengeschlossen, um möglichst viele Kreisläufe zu schliessen – von der Landwirtschaft über die Energie, die Verarbeitung und den Handel bis hin zur Gastronomie. Ziel ist es auch, die Erfahrungen aus diesem Projekt zu teilen, so dass auch über die Region hinaus Impulse gesetzt werden können.

Ein weiteres NRP-Projekt wurde im Kanton Waadt realisiert: «Diagnostic de l'économie circulaire dans le Nord vaudois». Im Rahmen dieses Projekts hat die Firma STRID SA, welche in der Abfallwirtschaft tätig ist, eine grossangelegte Studie lanciert, um Initiativen, Projekte und Anstösse im Rahmen der Kreislaufwirtschaft in der Region zu erheben und so Synergien zu identifizieren sowie die Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Akteuren zu fördern. Das übergeordnete Ziel besteht darin, das Abfallaufkommen zu reduzieren und gleichzeitig die lokale Wirtschaft zu fördern.
Fazit
Die Kreislaufwirtschaft bietet Potenzial, um ökologische, ökonomische und gesellschaftliche Herausforderungen gleichzeitig anzugehen. Sie fördert nicht nur den schonenden Umgang mit Ressourcen und den Schutz der Umwelt, sondern stärkt auch die Innovationskraft und Resilienz der Unternehmen. Die Ergebnisse des Statusberichts 2024 zeigen, dass erste wichtige Schritte hin zur Kreislaufwirtschaft unternommen wurden. Insbesondere in ländlichen Zentren und periurbanen Regionen gibt es bereits zahlreiche innovative Unternehmen. Gleichzeitig kämpfen gerade Unternehmen in strukturschwächeren Regionen mit grösseren Hemmnissen.
Durch den Wissensaufbau, die Vernetzung relevanter Akteure und Projektfinanzierungen, leistet die NRP einen zentralen Beitrag zur Förderung der Kreislaufwirtschaft in den Regionen. Damit trägt sie dazu bei, innovative Lösungen zu entwickeln und stärkt dadurch nicht nur die ökologische und ökonomische Resilienz vor Ort, sondern trägt auch zur nachhaltigen Entwicklung im Sinne einer zukunftsfähigen Regionalwirtschaft bei.