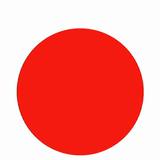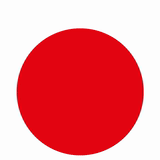- Die Gesamtbeschäftigung in der Schweiz hat sich in den letzten Jahren erhöht. Im Zuge dieser Entwicklung hat sich auch die Wirtschaftsstruktur verändert. Darin widerspiegelt sich der von Technologie, Demographie und Globalisierung getriebene Strukturwandel.
- Grösstenteils sind es in ländlichen und urbanen Gebieten dieselben Branchen, die durch den Strukturwandel grössere Beschäftigungsveränderungen erfahren haben.
- An Bedeutung gewonnen haben in den letzten Jahren insbesondere das Gesundheits- und Sozialwesen sowie das Grundstücks- und Wohnungswesen. Andere Wirtschaftszweige weisen dagegen ein rückläufiges Beschäftigungsvolumen auf, so z.B. das verarbeitende Gewerbe oder die Landwirtschaft.
Der Strukturwandel beeinflusst die Beschäftigungsentwicklung
Im Zeitraum 2011 bis 2021 wurden in der Schweiz rund 400'000 neue vollzeitäquivalente Stellen (VZÄ) geschaffen. Die meisten neuen Stellen sind in periurbanen und urbanen Gebieten entstanden. Demgegenüber ist die Beschäftigung in den ländlichen Gemeinden nur unterdurchschnittlich stark gewachsen. Neben den in der Analyse der Beschäftigungsentwicklung bereits angesprochenen Gründen (tiefe Wettbewerbsfähigkeit, schlechtere Erreichbarkeit, schwache Neugründungsdynamik) hat auch die Wirtschafts- bzw. Branchenstruktur einen Einfluss auf diese Entwicklung.
Die Branchenstruktur ist deshalb wichtig, weil mit dem Beschäftigungswachstum ein steter, durch Technologie, Demographie und Globalisierung getriebener Strukturwandel einher geht. Gibt es grosse Unterschiede in der Beschäftigungsentwicklung der verschiedenen Wirtschaftszweige, so wirkt sich dies – aufgrund der unterschiedlichen Branchenstruktur – auch auf das das Wachstum der Gesamtbeschäftigung in den einzelnen Regionen aus.
Die untenstehende Abbildung zum Branchenmix (Anteil verschiedener Branchen an der Gesamtbeschäftigung) zeigt, welche Branchen in den einzelnen regiosuisse-Raumtypen wie stark vertreten sind. Während in den ländlichen Gebieten insbesondere das verarbeitende Gewerbe und die Landwirtschaft gut vertreten sind, weisen die urbanen Gebiete u.a. in der Finanzindustrie sowie im Grundstück- und Wohnungswesen überdurchschnittlich hohe Beschäftigungsanteile auf. Zudem wird ersichtlich, dass die urbanen Gebiete in der Tendenz einen produktiveren Branchenmix aufweisen als die ländlichen Gebiete (vgl. auch Exkurs).
Exkurs: Höhere Produktivität in den Städten
Der nach Produktivität geordnete Branchenmix verdeutlicht, dass die ländlichen Gebiete einen vergleichsweise hohen Beschäftigungsanteil in unterdurchschnittlich produktiven Branchen aufweisen. Zur Messung der Produktivität wird auf das Konzept der «Arbeitsproduktivität» zurückgegriffen. Diese errechnet sich aus der Bruttowertschöpfung geteilt durch die Anzahl Vollzeitäquivalente.
Der höhere Anteil an produktiven Branchen in urbanen Räumen widerspiegelt sich auch in den Zahlen zur Wirtschaftsleistung. So weisen die urban geprägten Kantone Basel-Stadt, Zug und Genf – gemessen am BIP pro Kopf – klar die höchste Wirtschaftsleistung auf. Mit gut CHF 175'000 pro Kopf weist der Kanton Zug beispielsweise ein 3-mal so hohes BIP pro Kopf auf wie der Kanton Uri.
Ähnliche Branchenentwicklung in den verschiedenen Raumtypen
Betrachtet man den Wachstumsbeitrag der einzelnen Branchen am gesamten Beschäftigungswachstum im Zeitraum 2011-2021, so zeigt sich über alle Raumtypen hinweg ein ähnliches Bild: Im Zuge der generellen Entwicklung hin zum Dienstleistungssektor sind viele neue Arbeitsplätze im Grundstücks- und Wohnungswesen (inkl. sonstige Dienstleistungen) sowie im Gesundheits- und Sozialwesen entstanden. Während das Grundstück- und Wohnungswesen insbesondere vom Bevölkerungswachstum der letzten Jahre profitiert hat, ist das Wachstum im Gesundheits- und Sozialwesen sowie der öffentlichen Verwaltung massgeblich steuerfinanziert – man profitierte also vom Wirtschaftswachstum anderer Branchen.
Ebenfalls in allen Raumtypen zulegen konnten das Baugewerbe, die Kunst- und Unterhaltungsbranche sowie das Bildungswesen. Am anderen Ende des Spektrums steht das verarbeitende Gewerbe. In dieser Branche ist die Beschäftigung im betrachteten Zeitraum stark zurückgegangen, wobei der Rückgang in den Städten und den periurbanen Gemeinden am grössten war. Ebenfalls negativ entwickelt hat sich die Beschäftigung in der Landwirtschaft. Dieser Rückgang wiegt in den ländlichen Gemeinden erwartungsgemäss am schwersten.
Gewisse Unterschiede zwischen Stadt und Land gibt es dennoch. So ist die Beschäftigung in der Finanzindustrie in den Grossstädten rückläufig, während sie in den Städten und den periurbanen Gemeinden leicht zulegen konnte. Dies könnte ein Indiz dafür sein, dass Finanzinstitute ihr Backoffice zum Teil aus den eher teuren Lagen in den Kernstädten an etwas weniger teure, aber dennoch gut erreichbare Lagen verschoben haben.
Starkes Beschäftigungswachstum im Sozialwesen
Wir haben bereits gesehen, dass gewisse staatsnahe Branchen wie das Gesundheitswesen und das Sozialwesen in den letzten Jahren ein sehr starkes Beschäftigungswachstum verzeichnen konnten. Eine differenziertere Betrachtung zeigt, dass das Sozialwesen in relativer Hinsicht am stärksten gewachsen ist. Demgegenüber war das relative Wachstum in der öffentlichen Verwaltung vergleichsweise gering. Hierbei gilt es aber anzumerken, dass das Gesundheitswesen aufgrund seiner Grösse in absoluten Zahlen mit 75'000 VZÄ (Zeitraum 2011-2021) rund doppelt so stark gewachsen ist wie das Sozialwesen.
Für das starke relative Wachstum im Sozialwesen gibt es verschiedene Gründe. Neben der demographischen Entwicklung (z.B. zunehmender Bedarf an Pflegepersonal in Altersheimen) und gesellschaftliche Veränderungen (z.B. vermehrte Drittbetreuung von Kindern) haben sich auch politische Initiativen (z.B. die Anschubfinanzierung für Angebote im Bereich der familienergänzenden Kinderbetreuung) auf die Beschäftigungsentwicklung ausgewirkt.
Da davon auszugehen ist, dass sich die erwähnten Trends fortsetzen, ist auch in naher Zukunft mit einem überdurchschnittlichen Wachstum im Gesundheits- und Sozialwesen zu rechnen.
Exkurs: Unterdurchschnittlich produktive Branchen wachsen schnell
Fast alle Branchen, die hohe relative Wachstumsraten aufweisen, sind unterdurchschnittlich produktiv. Dies betrifft insbesondere die Kunst- und Unterhaltungsbranche sowie das Bildungswesen, und – wie oben bereits im Detail betrachtet – auch die staatsnahen Branchen wie das Gesundheits- und Sozialwesen. Dabei gilt es aber anzumerken, dass sich die hohen Wachstumsraten teilweise auf Basis von tiefen absoluten Beschäftigungsniveaus im Ausgangszustand (z.B. Kunst- und Unterhaltungsbranche) ergeben. Zudem ist die üblicherweise zur Messung der Produktivität verwendete Arbeitsproduktivität nicht für alle Branchen gleich gut geeignet, weil zur Berechnung der Arbeitsproduktivität ein Produkt oder eine Dienstleistung monetär bewertet werden muss. Dies gestaltet sich z.B. bei sozialen Dienstleistungen oftmals schwierig.
Traditionelle Industrie in ländlichen Gebieten robuster
Das verarbeitende Gewerbe ist in den ländlichen und periurbanen Gemeinden stark vertreten, wo der Beschäftigungsanteil dieser Branche bei über 20% liegt. Wie bereits erwähnt, hatte das verarbeitende Gewerbe im Zeitraum 2011 bis 2021 einen starken Beschäftigungsrückgang zu verzeichnen.
Eine Unterteilung des verarbeitenden Gewerbes in die zwei Untergruppen «traditionelle Industrie» (z.B. Herstellung von Metallerzeugnissen, Textilindustrie usw.) sowie «Spitzenindustrie» (z.B. pharmazeutische Erzeugnisse, Maschinenbau, Herstellung von Datenverarbeitungsgeräten usw.) erlaubt einen tieferen Einblick in die Branche. Es zeigt sich, dass die Spitzenindustrie in den urbanen Räumen aktuell eine höhere Beschäftigung aufweist als die traditionelle Industrie – in den ländlichen Räumen ist es gerade umgekehrt.
Die Entwicklung der letzten Jahre zeigt, dass sich die traditionelle Industrie im ländlichen Raum besser gehalten hat als in den Städten (insbesondere die Nahrungs- und Futtermittelindustrie). Ein möglicher Grund für das gute Abschneiden im ländlichen Raum könnte darin liegen, dass viele dieser Unternehmen eine starke Inlandorientierung aufweisen und daher weniger stark unter der Wechselkursentwicklung der vergangenen Jahre gelitten haben.
Auch in den Grossstädten zeigt sich eine interessante Entwicklung: Einerseits ist die Beschäftigung in der traditionellen Industrie, welche insbesondere mit Verdrängungseffekten und steigenden Bodenpreisen zu kämpfen hatte, stark zurückgegangen. Andererseits konnte die Spitzenindustrie in der gleichen Zeit leicht zulegen (v.a. in der Herstellung pharmazeutischer und elektronischer Waren). Dies dürfte sich unter anderem im hohen Fachkräftebedarf und der vergleichsweise hohen Wertschöpfungsintensität dieser Branche begründen.